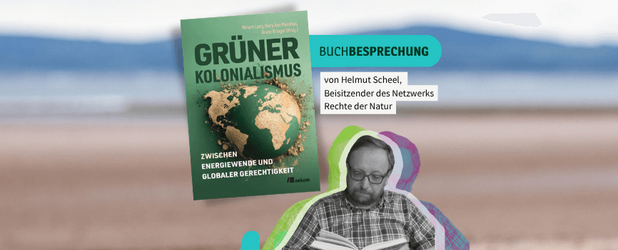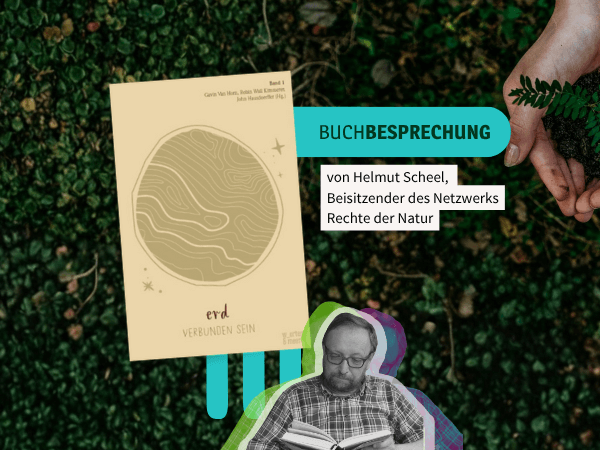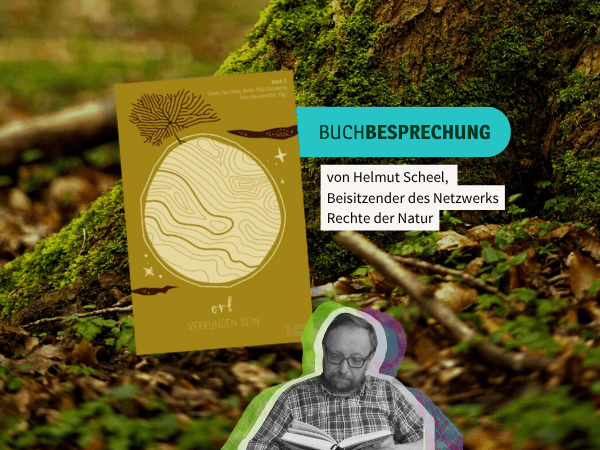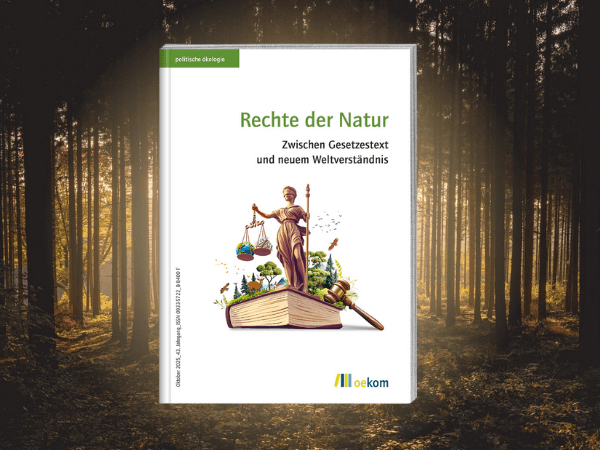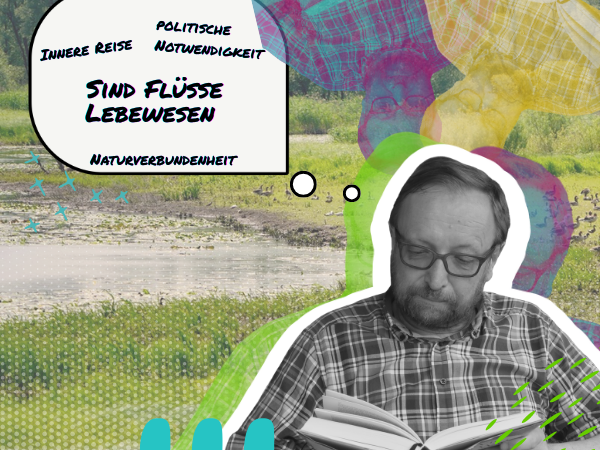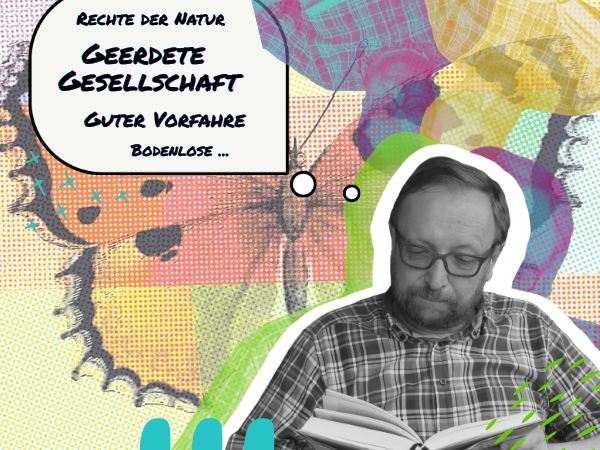Grüner Kolonialismus Hrsg. von Miriam Lang, Mary Ann Manahan und Breno Bringel
Wir glauben, der Kolonialismus gehöre der Vergangenheit an. Doch dieses Buch beweist: Er trägt heute nur einen grünen Anstrich. 25 Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Disziplinen legen schonungslos offen, was im globalen Norden gern verschwiegen wird: Die Energiewende, die uns als Rettung des Klimas verkauft wird, perpetuiert alte Machtstrukturen und schafft neue Abhängigkeiten. „Grüner Kolonialismus“ ist kein alarmistischer Begriff, sondern eine nüchterne Bestandsaufnahme.
Das Buch zeigt, wie internationale Organisationen wie WTO, IWF und Weltbank bis heute von Industrieländern dominiert werden und Länder des globalen Südens in ein System der Ausbeutung zwingen. Die Nationalstaatsgrenzen, die einst mit dem Lineal über ethnische und kulturelle Realitäten hinweg gezogen wurden, wirken bis heute nach. Während die Conquistadores einst Silber und Gold raubten, sind es heute Lithium, Kobalt und Kupfer dazugekommen und vor allem die Kontrolle über Land und Ressourcen im Namen des Klimaschutzes. Christian Dorninger bringt es auf den Punkt: „Die monetären Abflüsse in Preisen des Nordens übersteigen die Entwicklungshilfe um das 86-Fache“ (S. 128). Der sogenannte Trickle-Down-Effekt entpuppt sich als pervertierte Umverteilung von unten nach oben.
Ein besonders eklatantes Beispiel ist die Wasserstoffstrategie der EU. Im Rahmen des Green Deal soll in der Sahara großflächig Wasserstoff für den europäischen Markt produziert werden, auf Vorschlag des Branchenverbands Hydrogen Europe. Wie Hamaza Hamouchen beschreibt, werden dafür Flächen als „leer“ deklariert, obwohl Hirten- und Bauernvölker seit Generationen von ihnen leben. Ihnen wird nicht nur die Lebensgrundlage entzogen, sondern auch das knappe Wasser, das für die Reinigung von Solaranlagen abgepumpt wird und die Verwüstung beschleunigt. Klimaschutz? Oder neokoloniale Landnahme?
Doch das Buch bleibt nicht bei der Kritik stehen. Es zeigt auch, wie Widerstand aussieht. Farida Akhter berichtet vom „Nayakrishi Andolon“ in Bangladesch, einer von Frauen getragenen Bewegung, die über 2.700 traditionelle Reissorten sammelte; eine genetische Vielfalt, die Bäuerinnen gegen die Abhängigkeit von Agrarkonzernen und gentechnisch manipulierten Sorten wie Golden Rice einsetzen. Hier wird klar: Die Lösungen für die Klimakrise liegen oft dort, wo wir sie am wenigsten suchen – im Wissen und in den Praktiken derer, die am stärksten von ihr betroffen sind.
Ein zentrales Thema des Buches ist die Doppelte Entrechtung: Sowohl indigene Gemeinschaften als auch die Natur selbst haben kaum Rechte. Beide werden ausgebeutet, weil sie als „verfügbar“ gelten. Die Forderung nach Rechten für indigene Völker und Rechte der Natur ist daher kein idealistischer Traum, sondern eine Notwendigkeit für globale Gerechtigkeit.
In 18 Kapiteln deckt das Buch ein breites Spektrum ab, von Rohstoffabbau über Handelsabkommen bis zu alternativen Wirtschaftsmodellen. Wer bereit ist, hinter die grüne Fassade der Energiewende zu blicken, wird hier fündig. Die Stärke des Buches liegt in seiner Vielfalt: Es vereint Analysen, Erfahrungsberichte und konkrete Handlungsvorschläge, die in dieser Form selten zu finden sind.
Mein Fazit: Wenn wir Natur, Klima und Menschheit eine lebenswerte Zukunft sichern wollen, müssen wir unser Denken radikal ändern. Es ist nicht der globale Süden, der sich „entwickeln“ muss, wir im Norden sind es, die von ihm lernen müssen. Statt seine Rohstoffe zu plündern, brauchen wir sein Wissen, seine Resilienzstrategien und seine andere Beziehung zur Natur. Vielleicht sollten wir endlich aufhören, von „Entwicklungsländern“ zu sprechen und stattdessen fragen: Wer entwickelt hier eigentlich wen? Im globalen Norden liegen die modernen Entwicklungsländer.
Wer dieses Buch liest, wird die Debatte um Klimapolitik mit anderen Augen sehen. Es ist Pflichtlektüre für alle, die verstehen wollen, warum Gerechtigkeit der Schlüssel zur ökologischen Wende ist.